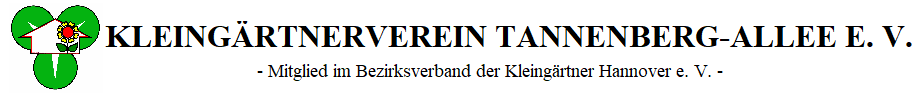Standfestigkeit und Blütezeit von Stauden verlängern
Spätblühende Stauden eignen sich hervorragend für den so genannten Chelsea-Chop (Vorblüteschnitt). Dabei werden die Blütenstängel spätblühender Stauden etwa um ein Drittel zurückgeschnitten. Ziel ist es zum einen, die Blütezeit zu verlängern und zum anderen die Standfestigkeit höherer Stauden zu verbessern. Grundsätzlich unterscheidet man bei der Technik zwischen zwei Varianten. Bei der ersten Variante kürzt man Ende Mai nur die äußeren Stängel der Stauden um ein Drittel. Die Blütenstängel wachsen kräftiger und standfester nach und verdecken die inneren, häufig kahlen Stängel. Besonders geeignet für diese Technik sind bspw. Stauden wie Phlox, Indianernessel, Astern und der Pupur-Sonnenhut.
Bei Stauden wie der Fetthenne „Herbstfreude“ wird die gesamte Pflanze Ende Mai auf ein Drittel zurückgeschnitten. Dadurch wächst sie kompakter und fällt später nicht auseinander.
Rasen düngen
Der Mai ist die Hauptdüngungszeit für den Rasen. Da dann bereits Bodenlebenwesen ausreichend aktiv sind, kann man statt mineralischem besser organischen Dünger verwenden. Im Handel gibt es davon mittlerweile eine große Auswahl. Eine günstige Auswahl ist fein gesiebter Kompost, den man dünn ausstreut und gut verteilt. Regenwürmer sorgen dann dafür, dass dieser Humus- und Nährstoffvorrat gut in den Boden eingearbeitet wird. Ganz nebenbei wird der Boden hierbei noch zusätzlich gelockert und belüftet.
Mit dem Vertikutieren des Rasens sollte man besser bis zum Herbst (September) warten. Da im Frühjahr vermehrt Trockenphasen auftauchen, wird Rasen – anders als noch vor Jahren – nicht mehr im Mai vertikutiert.
Monilia-Spitzendürre
Bei Kirschen kann es in nächster Zeit zu ersten Infektionen durch den Erreger der Monilia-Spitzendürre kommen: Hierbei infiziert der Schadpilz Monilinia laxa seine Wirtspflanzen über die Blüte. Erhöhte Infektionsgefahr besteht vor allem dann, wenn es zur Blütezeit der Kirschen kühl und regnerisch ist. Bei Befall sterben Blüten, Blätter und Triebe schon kurz nach der Blüte ab: Betroffene Triebspitzen sehen anschließend wie verdorrt aus, daher der Name Spitzendürre. Besonders anfällig sind Sauerkirschen, insbesondere die Sorte Schattenmorelle. Darüber hinaus können aber auch Süß- und Zierkirschen, Mandelbäumchen sowie Aprikosen und Pfirsiche befallen werden. Abgestorbene Triebteile einschließlich der Blütenbüschel bleiben oft noch bis über den anschließenden Winter hinweg weitgehend unverändert an den Ästen hängen. An ihnen überwintert der Pilz später dann auch.
Sollte es zu einem Befall gekommen sein, ist es deshalb zunächst sinnvoll, abgestorbene Triebspitzen bis deutlich ins gesunde Holz zurückzuschneiden: Der Rückschnitt kann schon kurz nach der Blüte erfolgen, spätestens ist er jedoch nach der Ernte durchzuführen. Generell sollten gefährdete Bäume sehr luftig und gut ausgeschnitten werden, um ein rasches Abtrocknen zu fördern und die Ausbreitung des Pilzes zu verhindern. Ein sonniger, luftiger Standort wirkt befallsreduzierend.
Sowohl im Gemüse- als auch im Blumengarten gibt es um diese Zeit eine Menge zu säen und zu pflanzen. Viele Sommerblumen können gleich ins Freiland gesät werden. Dazu gehören Ringelblumen, Wicken, Kapuzinerkresse, Sonnen-, Korn-, Kreuz-, Stroh¬ und Schleifenblumen. Wem die Asternwelke im Garten Kummer bereitet, der sollte einmal versuchen, auch Astern gleich an Ort und Stelle auszusäen und später auf die richtigen Abstände zu verziehen. Meist bleiben solche Pflanzen gesund. Die Erreger der Asternwelke, Bodenpilze, dringen nämlich durch Wunden an den Wurzeln in das Innere der Pflanzen. Astern, deren Wurzeln nicht durch ein Verpflanzen verletzt wurden, sind darum weniger gefährdet.
Gewächshaus
Jetzt wird nach und nach der Platz unter Glas frei, und wir müssen uns nun Gedanken machen, wie wir diese wertvolle Fläche im Sommer nutzen können. Es gibt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, aber sie alle wollen sorgfältig vorbereitet werden. In Gewächshäuser pflanzt man sehr gerne Tomaten, Gurken oder Paprika. Dabei wird vergessen, dass Tomaten und Gurken nicht zusammen in ein Haus gesetzt werden dürfen, denn ihre Ansprüche sind zu verschieden. Zwar berichten mir Kunden immer wieder, bei ihnen gelänge es gut, die beiden unter einem Dach heranzuziehen, doch das sind Einzelfälle. Im allgemeinen klappt dieses Zusammenleben nämlich nicht.
Mitte des Monats, wenn die Frostgefahr vorüber ist und sich der Boden auf mindestens 15 °C erwärmt hat, können Sie Ihre Tomaten ins Freie pflanzen. Das Beet können Sie aber bereits ein bis zwei Wochen vorher vorbereiten. Lockern Sie dazu die Erde tiefgründig und arbeiten Sie 3–5 l reifen Kompost pro m² ein. Damit die Pflanzen später gesund bleiben und nicht von Krautfäule befallen werden, ist es ratsam, sie mit einem Dach vor Regen zu schützen. Denn die Pilzsporen benötigen Feuchtigkeit, um keimen zu können. Einen wirksamen Schutz bieten spezielle Tomatenhäuser oder selbst gebaute Überstände. Folienschläuche oder Tomatenhauben sind dagegen nicht zu empfehlen, denn unter ihnen bildet sich Kondenswasser, welches sich auch auf den Blättern niederschlägt.
Wenn Sie Ihre Tomatenpflanzen bisher auch immer nur mit dem Topfballen nach unten eingepflanzt haben, versuchen Sie mal folgende Methode. Entblättern Sie zunächst den unteren Stielbereich der Pflanzen. Heben Sie dann ein etwas größeres und tieferes (ca. 10 cm) Pflanzloch aus und legen Sie den Wurzelballen flach hinein. Biegen Sie nun den Trieb vorsichtig nach oben und füllen Sie das Loch wieder mit Erde auf. Am gesamten Stiel bilden sich so zusätzliche Wurzeln, und das bedeutet: mehr Wurzeln gleich mehr Nährstoffe gleich mehr Tomaten.
Sowohl Tomaten als auch Gurken mögen es warm, aber das ist schon die einzige Gemeinsamkeit. Gurken verlangen eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, während Tomaten trockene Luft vorziehen, da sie sonst unter Pilzkrankheiten leiden. Andererseits fallen Gurken Spinnmilben und der Weißen Fliege zum Opfer, wenn sie ständig trockener Luft ausgesetzt sind. Treten diese Probleme auf, wird als Grund nicht der gemeinsame Anbau der beiden Kulturen erkannt, sondern es wird versucht, mit den verschiedensten Mitteln Krankheiten und Schädlinge zu bekämpfen, meist ohne nennenswerten Erfolg. Dabei hätte man leicht diese Probleme vermeiden können.
Tipp: Mischen Sie dem Kompost bei der Beetvorbereitung etwas Geteinsmehl oder Algenkalk bei, dadurch wird die Bodenbeschaffenheit verbessert und der Mineralhaushalt ausgeglichen.
Nützlinge fördern
Ohrwürmer sind Nützlinge , die Blattläuse auf euren Obstbäumen verzehren. Um den nachtaktiven Blattlausfressern Unterschlupf zu bieten, solltet ihr mit Stroh oder mit Holzwolle gefüllte Blumentöpfe umgekehrt in die Bäume hängen. Die Töpfe müssen direkten Stammkontakt haben, sonst werden sie nicht angenommen.
W.D.K / S. J.